20. Oktober 2023, Museum Neukölln, Berlin
8. November 2023, Seminar ‚Understanding Politics‘, Bard College, Berlin
5. Dezember 2023, Forschungskolloquium zur Europäischen Geschichte, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
20. Oktober 2023, Museum Neukölln, Berlin
8. November 2023, Seminar ‚Understanding Politics‘, Bard College, Berlin
5. Dezember 2023, Forschungskolloquium zur Europäischen Geschichte, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Zum Buch beim Wallstein Verlag: https://www.wallstein-verlag.de/9783835350182-hamburg-tor-zur-kolonialen-welt.html
Zum Buch bei Amazon: https://www.amazon.de/Hamburg-kolonialen-Erinnerungsorte-Globalisierung-Geschichte/dp/3835350188
Zum Buch bei Geniallokal: https://www.genialokal.de/Produkt/Hamburg-Tor-zur-kolonialen-Welt_lid_44873803.html
Als wichtigster Hafen Deutschlands war Hamburg auch zentrale Kolonialmetropole. Das »Tor zur Welt« war über Jahrhunderte ein Tor zur kolonialen Welt. Man hatte Handelsbeziehungen zu Kolonialmächten und Kolonien, man handelte mit Kolonialwaren und auch mit Menschen. Diese Geschichte hat Spuren hinterlassen.
Hamburg ist voller (post-)kolonialer Erinnerungsorte, die nicht nur für die Stadtgeschichte interessant sind, sondern auch Aufschluss geben über die Geschichte der kolonialen Globalisierung.
Die untersuchten Erinnerungsorte reichen von Vorstellungswelten wie der Figur des »Hanseaten« über Institutionen der Kolonialwirtschaft und -politik wie dem Hafen oder der Handelskammer, einzelnen Unternehmen wie dem Woermann-Konzern bis zu Wissenschaft, Kultur und Kunst, etwa dem Museum für Völkerkunde (heute MARKK) oder dem Tierpark Hagenbeck und seinen »Völkerschauen«. Auch die Geschichte einzelner Denkmäler wie dem großen »Bismarck« am Hafen oder den »Askari-Reliefs« wird untersucht. Ergänzt um biographische Skizzen wird deutlich, was der Kolonialismus für Hamburg bedeutet, aber auch Hamburg für den Kolonialismus.
Am 25.10.2021 erscheint im Wallstein Verlag der Sammelband „Hamburg: Tor zur kolonialen Welt. Erinnerungsorte der (post-)kolonialen Globalisierung“, der von Jürgen Zimmerer und mir herausgegeben wird.

Der Band kann ab sofort bei allen Buchhändlern vorbestellt werden. Hier geht es zur Verlagswebseite: https://www.wallstein-verlag.de/9783835350182-hamburg-tor-zur-kolonialen-welt.html
Weitere Informationen:
Als wichtigster Hafen Deutschlands war Hamburg auch zentrale Kolonialmetropole. Das »Tor zur Welt« war über Jahrhunderte ein Tor zur kolonialen Welt. Man hatte Handelsbeziehungen zu Kolonialmächten und Kolonien, man handelte mit Kolonialwaren und auch mit Menschen. Diese Geschichte hat Spuren hinterlassen.
Hamburg ist voller (post-)kolonialer Erinnerungsorte, die nicht nur für die Stadtgeschichte interessant sind, sondern auch Aufschluss geben über die Geschichte der kolonialen Globalisierung.
Die untersuchten Erinnerungsorte reichen von Vorstellungswelten wie der Figur des »Hanseaten« über Institutionen der Kolonialwirtschaft und -politik wie dem Hafen oder der Handelskammer, einzelnen Unternehmen wie dem Woermann-Konzern bis zu Wissenschaft, Kultur und Kunst, etwa dem Museum für Völkerkunde (heute MARKK) oder dem Tierpark Hagenbeck und seinen »Völkerschauen«. Auch die Geschichte einzelner Denkmäler wie dem großen »Bismarck« am Hafen oder den »Askari-Reliefs« wird untersucht. Ergänzt um biographische Skizzen wird deutlich, was der Kolonialismus für Hamburg bedeutet, aber auch Hamburg für den Kolonialismus.
Virtual Conference, 5th and 6th May 2021
Until well into the 1980s, economic history was an integral part of German colonial historiography, but it then declined as a significant focus of historical research. Instead, social and cultural studies have predominated, with important work appearing on colonial violence, gender, medicine, and metropolitan cultures of colonialism, among other topics. While these studies have shed new light on many aspects of colonialism, especially of the repercussions of colonialism on Germany, they are at times Eurocentric and understate the importance of economics to colonialism by not directly engaging with local, non-European actors and the economic structures of specific colonies. In other words, the conditions and consequences as well as the local embeddedness of colonial economies have been, at times, out of focus.
Recently, historians have begun re-centering economics, combining cultural approaches with fresh methodologies and new sources to build a more complete picture of the interplay of economic development with German colonial rule. These historians are aided by new approaches in other areas of historiography which have explicitly championed moving economics back to the center. The “New History of Capitalism”, “Global Labor History” or the “New Materialism” rediscovered capitalism as an analytical concept and replaced the discourse of cultural history with the material world. Researching e.g. the interplay between companies, markets and the state, the relationship between capitalism and various, often hybrid forms of labor mobilization (from wage labor to slavery) or the connection between capitalism and violence, these new approaches analyze “capitalism in action”, as Sven Beckert and Christine Desan put it. This emerging field and the important debates related to it show that analyzing the economic as well as social structures and relationships of Germany’s encounter with the colonial world have the potential to spark new perspectives and new debates.
The planned workshop brings together international historians of German colonialism, with special emphasis on scholars at the doctoral and postdoctoral level, who explore German colonial capitalism and put its economic conditions, material aspects and social structures at the heart of their research. It concentrates the knowledge of scholars of the various local contexts in Africa, Asia, Latin America as well as Oceania, in which German colonial actors were economically active. Thereby, it wants to promote new perspectives on German colonial history, in academia as well as in the broader public, which, in lieu of imperial discourse, underline local experience and social and material realities in the colonial situation.
In order to widen and deepen our perspective and understanding, the workshop explores the economic dimensions of a broad notion of German colonialism, by neither temporarily nor spatially limiting it to the formal German colonial Empire (1884-1919). As recent studies have shown, older connections and postcolonial continuities should not be overlooked. Some economic relationships began long before colonial rule and outlived them. Furthermore, economic networks were not limited to formal German colonies but often crossed imperial borders. Therefore, in addition to research on Germany’s Empire, this workshop aims at also bringing in research on economic contacts between Germany and other parts of the colonial world in Africa, Asia, Latin America and Oceania. Thereby, the workshop seeks to uncover unknown continuities, interconnections, and exchanges which would otherwise have been invisible. Moreover, this workshop is an invitation to include other approaches to the past of the non-European world in the history of German colonialism which have only rarely been included – like Atlantic History, Migration History, Maritime History, the History of Islam, to name but a few.
Conceptual questions that will be discussed during the workshop feature inter alia: How colonial was the colonial economy? What role does the use of coercion and violence play in colonial capitalism? Which older forms of economic activity were continued, which were newly developed, and which outlived formal colonial rule? How did colonial business change local economies, e.g. forms of labor, agriculture, production, or commerce? Which new connections of trade or migration were built inside colonies or with places elsewhere? Which older connections were terminated? How did German businesses interact with local economic, social and political structures – and which role played colonial states?
Proposals for papers should include the title, an abstract of maximum 300 words and a short CV of the applicant. Please send proposals to colonialcapitalism@gmail.com before 15 January 2021. Notifications of acceptance will be announced in early February. Participants are expected to submit a 2,000 – 4,000-word preliminary paper ahead of the workshop in April.
Due to the current Covid-19 pandemic, the workshop will be hosted online, using Zoom. We particularly encourage scholars from the Global South to send their contributions. Limited funding is available for material costs incurred in connection with participation (SIM cards, data volume, etc.). Please indicate in case of an application whether you need to make use of this. For further information and questions please contact us at colonialcapitalism@gmail.com.
Conveners:
The virtual conference is held in cooperation with:
von Kim Sebastian Todzi
Hamburg gilt als das „Tor zur Welt“. Häufig wird dabei vergessen oder ignoriert, dass diese Welt bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts eine überwiegend koloniale Welt war und viele Hamburger und Hamburgerinnen auch lange vor der Annexion von Kolonien durch das Deutsche Reich ab 1884 von dieser kolonialen Ordnung profitierten.
Als Kolonialismus definiert Jürgen Osterhammel:
„Kolonialismus ist eine Herrschaftsbeziehung zwischen Kollektiven, bei welcher die fundamentalen Entscheidungen über die Lebensführung der Kolonisierten durch eine kulturell andersartige und kaum anpassungswillige Minderheit von Kolonialherren unter vorrangiger Berücksichtigung externer Interessen getroffen und tatsächlich durchgesetzt werden. Damit verbinden sich in der Neuzeit in der Regel sendungsideologische Rechtfertigungsdoktrinen, die auf der Überzeugung der Kolonialherren von ihrer eigenen kulturellen Höherwertigkeit beruhen.“[1]
Bereits in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde Hamburg zum größten Zuckerraffinationszentrum Europas. Der Rohzucker wurde vor allem in der Karibik auf Plantagen von versklavten Menschen angebaut und dann über London, Liverpool, Bordeaux, Cádiz und Amsterdam nach Hamburg verschifft, wo er für die europäischen Märkte weiterverarbeitet wurde. Hamburger Kaufleute und Gewerbetreibende waren so direkte Nutznießer*innen des sogenannten „Dreieckshandels“, in welchem versklavte Menschen als „Waren“ aus Afrika in die Karibik, von dort produzierte Rohstoffe wie Rohzucker nach Europa und von Europa wiederum Manufakturwaren, Stoffe, Waffen und Alkohol nach Afrika gehandelt wurden. Ende des 18. Jahrhunderts waren in Hamburg die wichtigsten Gewerbe neben dem Handel die Zuckersiederei und die Baumwollveredelung. Produkte und Gewerbe also, die ganz elementar mit dem europäischen Kolonialismus, mit Plantagenwirtschaft und dem Versklavungshandel verbunden waren.Im Lauf des 19. Jahrhunderts konnten Hamburger Kaufleute durch die Ausbreitung des Freihandels, also der Beseitigung von Handelsmonopolen und anderen Handelshemmnissen, unter der Hegemonie des britischen Empires ihre Handelsaktivitäten weltweit ausdehnen. Hatten die Hamburger Handelshäuser bisher nur selten direkten Handel mit Gebieten außerhalb Europas getrieben, sondern Waren nur über den Umweg über die Handelszentren der europäischen Kolonialmächte wie London, Liverpool, Bordeaux, Cádiz und Amsterdam bezogen, veränderte sich dies durch die erste Dekolonisationswelle südamerikanischer Staaten zwischen 1809 und 1825 und den allmählichen Übergang vom Merkantilismus zum Freihandel. Das veranlasste Martin Haller, den Präses der Hamburger „Commerzdeputation“ (der späteren Handelskammer) 1822 zu dem paradoxen Ausspruch: „Hamburg hat Colonien erhalten.“[2] Nach Hallers Ausspruch dauerte es aber noch über sechzig Jahre, bis unter dem Reichskanzler Otto von Bismarck das Deutsche Reich die formelle Kolonialherrschaft über Gebiete in Afrika und der Südsee proklamierte.
Hamburgs Wirtschaft expandierte im 19. Jahrhundert stetig und die Hafenstadt wurde zu einem der größten europäischen Handelszentren. Etwas zeitversetzt zum wirtschaftlichen Aufstieg nahm ab den späten 1870er Jahren auch die Diskussion über die Errichtung eines deutschen Kolonialreiches zu. Ende des 19. Jahrhunderts verschärften sich die imperialen Rivalitäten europäischer Kolonialmächte vor allem in Afrika. Beschränkte sich die europäische Kontrolle um 1850 auf wenige Küstengebiete und Südafrika, änderte sich dies in den folgenden Jahrzehnten grundlegend. Beim „Wettlauf um Afrika“ gerieten bis 1914 alle Gebiete Afrikas – außer Liberia und Äthiopien – unter europäische Kontrolle.
Kolonialreichsgründung
In dem noch jungen Deutschen Kaiserreich drängte eine einflussreiche Kolonialbewegung darauf, ebenfalls überseeische Kolonien zu erwerben und dem Reich einen sprichwörtlichen „Platz an der Sonne“ zu sichern. Kolonialpropagandisten wie Friedrich Fabri oder Wilhelm Hübbe-Schleiden argumentierten, dass Kolonien dem Deutschen Reich erstens als Absatzgebiete und zweitens als Rohstoffquellen dienen würden und drittens die Auswanderung aus Deutschland statt nach Amerika in deutsche Kolonien gelenkt werden könnte. (Siehe Quelle Fabri) Viele Hamburger und Hamburgerinnen sahen koloniale Erwerbungen zunächst jedoch eher skeptisch. Nur wenige waren vom Erfolg einer aktiven Kolonialpolitik überzeugt, denn die meisten Kaufleute befürchteten hohe Kosten und Auseinandersetzungen mit den anderen europäischen Kolonialmächten. Noch 1899 beklagte sich die nationalliberale Zeitschrift „Der Grenzbote“, dass „nirgends der koloniale Gedanke kühler aufgenommen worden ist, als in Hamburg und Bremen“[3]. Dennoch gelang es einer kleinen Gruppe Hamburger Kaufleute um den „königlichen Kaufmann“ Adolph Woermann ihre wirtschaftlichen Individualinteressen mit den Interessen des kolonial expandierenden Nationalstaates zu verbinden und somit die Grundzüge des deutschen Kolonialismus mitzubestimmen.
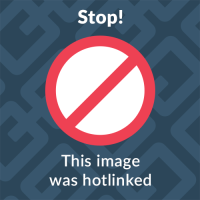
Hamburger Handelshäuser wie C. Woermann, G. L. Gaiser oder Jantzen & Thormählen importierten aus Westafrika Palmöl und Kautschuk und exportierten Alkohol, Baumwollstoffe, Waffen und Manufakturwaren. Adolph Woermann übernahm 1880 von seinem Vater das Familienunternehmen C. Woermann, das seit Mitte des 19. Jahrhunderts in Westafrika Handel trieb und bereits seit 1868 erste Handelsstationen an der Mündung des Wouri-Flusses im heutigen Kamerun gründete. C. Woermann wurde bald zum wichtigsten deutschen Unternehmen in Westafrika, und Adolph Woermann erkannte, dass die neue Kolonialbewegung auch seinem Geschäft neue Möglichkeiten versprach. In einem Vortrag vor der Geographischen Gesellschaft in Hamburg sprach Woermann 1879 das erste Mal von den „ungehobenen Schätzen“ des inneren Afrikas: „Es liegt auf der Hand, dass in Afrika zwei grosse ungehobene Schätze sind: Die Fruchtbarkeit des Bodens und die Arbeitskraft vieler Millionen Neger. Wer diese Schätze zu heben versteht, und es kommt nur auf die richtigen Leute dabei an, der wird nicht nur Geld verdienen, sondern auch gleichzeitig eine grosse Kultur-Mission erfüllen.“[4]
Das subsaharische Afrika wurde zum Möglichkeitsraum und zum Ziel einer ökonomischen, wissenschaftlichen und „zivilisatorischen“ Durchdringung des Kontinents – auch gegen den Willen der jeweiligen einheimischen Bevölkerungen.
Auf der Basis eines von Woermann entworfenen Konzeptes forderte die Hamburger Handelskammer im Juli 1883 in einer Denkschrift die Regierung des Deutschen Reiches auf, Kolonien in (West-)Afrika zu erwerben. Diese Denkschrift gab Bismarck, der Kolonien zunächst selbst eher ablehnend gegenüberstand, eine gute Argumentationshilfe für die folgende Kolonialreichsgründung. Bismarck sah den Erwerb von Kolonien zunächst vor allem als mögliche Konfliktursachen mit anderen europäischen Kolonialmächten und fürchtete die hohen staatlichen Kosten der Kolonialverwaltung. Daher sollten die neuen Kolonien auch als „Schutzgebiete“ gemäß dem Motto „die Flagge folgt dem Handel“ behandelt werden, deutsche Handelsinteressen durch die Bildung von „Chartered Companies“, also staatlich garantierten Privatunternehmen, abgesichert werden.
Ab 1884 erwarb das Deutsche Reich dann sogenannte „Schutzgebiete“ in Afrika, Asien und im Südpazifik: dazu zählten u.a. Togo, Kamerun, „Deutsch-Südwestafrika“ (Namibia), „Deutsch-Ostafrika“ (Tansania, Ruanda und Burundi), Kiautschou in China und einige Inseln im Pazifik, die „Deutschen Schutzgebiete in der Südsee“.
Tor zur Welt – Kolonialmetropole des Deutschen Kaiserreichs
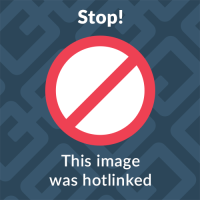
Hamburg stieg in den folgenden Jahren zur Kolonialmetropole des Kaiserreichs auf. Der Hafen verband die Kolonien mit dem Deutschen Reich. Zahlreiche Reedereien – wie die Woermann-Linie oder Deutsch-Ost-Afrika-Linie –, Handels- und Plantagenunternehmen hatten hier ihren Sitz. Kolonialwaren wie Palmöl, Elfenbein, Kaffee, Zimt, Kakao, Bananen und Tee wurden seit 1888 in der neu erbauten Speicherstadt, dem damals größten zusammenhängenden Lagerkomplex der Welt, gelagert und von dort weiter verkauft. Vom Hamburger Hafen liefen die Schiffe aus, auf denen Produkte in die (deutschen) Kolonien exportiert wurden. Das waren neben einem großen Teil hochprozentigen Alkohols vor allem Kleidung und Stoffe aus Baumwolle, Waffen und Munition sowie Salz.
Der Hamburger Hafen wurde aber auch zur Drehscheibe menschlicher Mobilität im Kaiserreich. Hamburg war häufig die letzte Station von Kolonialbeamten, Missionar*innen, Kaufleuten und Siedlern*innen, die in die Kolonien gingen, bevor sie auf Schiffen der Woermann-Linie und der Deutschen Ost-Afrika Linie ausreisten. Zugleich war Hamburg die erste Station von Menschen aus den Kolonien, die wie Mpundu Akwa für eine Ausbildung oder wie Samson Dido als Teilnehmer einer von Hagenbeck veranstalteten Völkerschau aus Kamerun nach Deutschland reisten.
Den Hamburger Anspruch das Tor zur (kolonialen) Welt darzustellen, unterstrichen die Errichtung eines eigenen Völkerkundemuseums (1879), das 1912 in seinen repräsentativen Bau an der Rothenbaumchaussee einzog und 1908 die Gründung des Kolonialinstituts, aus dem nach dem Ende des Ersten Weltkrieges die Hamburger Universität hervorging. Diese Institutionen waren wie auch die Völkerschauen im Tierpark Hagenbeck eng mit der kolonialen Ideologie und Kultur verbunden , welche die Kolonialherrschaft als „Zivilisierungsmission“ überhöhen und zugleich die Gewaltherrschaft des Kolonialismus verschleiern sollten.
Gewalt, Widerstand und Repression
Kolonialismus war eine besonders gewaltvolle Form der Herrschaft. Gewalt zur Durchsetzung der Kolonialherrschaft war ein konstitutiver Bestandteil des europäischen Kolonialismus. Nach Aimé Césaire, einem der bedeutendsten afrokaribischen Schriftsteller und Begründer der Négritude-Bewegung, war das Verhältnis zwischen Kolonisator und Kolonisierten von einer besonders brutalen und gewaltsamen Beziehung gekennzeichnet: “Ich schaue mich um und überall wo sich Kolonisatoren und Kolonisierte begegnen sehe ich Gewalt, Brutalität, Grausamkeit, Sadismus, Konflikt […]. Kein menschlicher Kontakt, sondern Beziehungen von Herrschaft und Unterwerfung, welche den Kolonisatoren in den Überwacher eines Klassenzimmers verwandeln, einen Feldwebel, einen Gefängniswärter, einen Sklaventreiber.“ [5]
Neben alltäglicher und in allen Kolonien präsenter Gewalt, die sich z.B. in der Entrechtung der kolonisierten Bevölkerung und einem daraus resultierenden dualen Rechtssystem, also einer unterschiedlichen Rechtsprechung für Kolonisierte und Kolonisatoren, Formen der Zwangsarbeit und Anwendung der Prügelstrafe und anderer körperlicher Übergriffe zeigte, führte die Entgrenzung der Gewalt in kriegerischen Auseinandersetzungen bis zum Völkermord.
Die Expansion und Aufrechterhaltung der Kolonialherrschaft war auf militärische Gewalt angewiesen. Bei jedem Vordringen europäischer Kolonisatoren stießen diese auf Widerstand. Bereits im September 1884 begann in Kamerun der Widerstand eines Duala-Clans, der sich weigerte die deutsche Kolonialherrschaft anzuerkennen. Zwei deutsche Kriegsschiffe kamen zur „Befriedung“, und schlugen den Widerstand brutal nieder. In den folgenden Jahren gab es in fast allen Kolonien immer wieder Widerstand, der mit „Strafexpedition“ genannten Kriegszügen brutal bekämpft und niedergeschlagen wurde. Einen Höhepunkt erreichte der Widerstand nach der Jahrhundertwende als mit den Kriegen gegen die Herero und Nama (1904–1907) in Deutsch-Südwestafrika und dem Maji-Maji-Krieg in Deutsch-Ostafrika (1905–1907) die langwierigsten und verlustreichsten Kolonialkriege des Deutschen Reiches geführt wurden.
Völkermord
In Deutsch-Südwestafrika leisteten die dort lebenden Herero ab Januar 1904 großflächig Widerstand gegen die deutsche Kolonialherrschaft. Die Herero waren dabei zunächst überaus erfolgreich, besetzten einen großen Teil Zentralnamibias und plünderten teilweise die Farmen der Siedler*innen, wobei sie jedoch ausdrücklich deutsche Frauen und Kinder schonten.
Die drohende Niederlage versuchte die Kolonialmacht mit der Ernennung Lothar von Trothas zum Kommandeur der „Schutztruppe“ abzuwenden, der bereits bei der Bekämpfung des „Boxeraufstandes“ in China Erfahrungen in der Niederschlagung von Widerstandsbewegungen gesammelt hatte. Das Vorgehen der Deutschen in China entsprach den Vorstellungen ihres Kaisers: Keinen Widerstand dulden, Härte auch gegen Zivilbevölkerung. Lothar von Trotha war überzeugt davon, einen „Rassekrieg“ gegen die Herero zu führen, und wollte den Widerstand mit extremer Brutalität und schließlich der Vernichtung der Herero beenden: „Gewalt mit krassem Terrorismus und selbst mit Grausamkeit auszuüben, war und ist meine Politik. Ich vernichte die aufständischen Stämme in Strömen von Blut und Strömen von Geld. Nur auf dieser Aussaat kann etwas Neues entstehen.“[6]
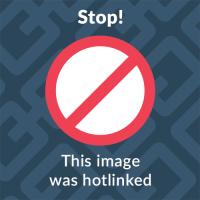
Im Sommer 1904 versuchten die deutschen Truppen am Waterberg eine Entscheidungsschlacht herbeizuführen. Es gelang bis zu 60.000 Herero, aus der Umzingelung zu entkommen und in die Omaheke-Wüste zu fliehen. Von Trotha ließ dort die Wasserstellen besetzen und erließ am 2. Oktober 1904 den „Schießbefehl“: Jede*r Herero, die oder der sich den Wasserstellen näherte, sollte erschossen oder vertrieben werden. Dieser Befehl bedeutete eine Vernichtungsabsicht und dokumentiert damit den Beginn des Völkermordes, denn ohne Zugang zu Wasser mussten tausende Herero qualvoll verdursten. Anschließend kam es unter anderem zu einer Politik der „verbrannten Erde“ gegen die Nama, die nach der Schlacht am Waterberg unter Hendrik Witbooi ebenfalls Widerstand leisteten und einen Guerillakrieg gegen die deutsche Kolonialmacht führten. Schließlich wurden „Konzentrationslager“ (zeitgenössischer Begriff) errichtet, in denen tausende gefangene Herero und Nama aufgrund von mangelhafter Ernährung, Krankheiten und Vernachlässigung starben.
Hamburg war dabei ein logistischer Knotenpunkt für den militärischen Nachschub während des Völkermordes. Ab 1901 verfügte die Woermann-Linie dank eines Vertrages mit der deutschen Kolonialverwaltung über das faktische Monopol zur Beförderung von Regierungspersonal und –gütern nach Deutsch-Südwestafrika. Während des Krieges unternahm die Woermann-Linie vom „Petersenkai“ im Baakenhafen die Transporte tausender Soldaten, Pferde und Kriegsmaterial in die Kolonie. Die Reederei betrieb ab 1905 ein eigenes Konzentrationslager und lieh sich vom Gouvernement Kriegsgefangene als Zwangsarbeiter aus. Das Monopol der Reederei veranlasste Matthias Erzberger 1906 im Reichstag zu seiner Kritik, dass Woermann als „Kriegsgewinnler“ das Reich bei den Frachtraten und Liegegebühren der Schiffe übervorteilt habe, die schließlich zur Auflösung der Verträge führte.
Erster Weltkrieg und Verlust der Kolonien
Als 1914 in Europa der Erste Weltkrieg ausbrach bereiteten sich britische und französische Truppen in Afrika darauf vor, die deutschen Kolonien zu erobern. Während Deutsch-Südwestafrika (August 1915), Kamerun (Anfang 1916) und Togo (August 1914) relativ schnell erobert wurden, führte der deutsche General Paul von Lettow-Vorbeck in Ostafrika bis Ende 1918 einen verlustreichen Guerillakrieg gegen die britischen Truppen, bei dem schätzungsweise mehr als 120.000 Menschen starben.
Nachdem Lettow-Vorbeck 1919 nach Deutschland zurückkehrte wurde er zum „Kolonialhelden“ stilisiert. Mit Unterzeichnung des Versailler Vertrages verlor Deutschland seine Kolonien, die der Völkerbund als Mandatsgebiete an die Siegermächte übergab. Dabei dienten Vorwürfe, die Deutschen seien unfähig zu kolonisieren, als Rechtfertigung der Wegnahme der Kolonien. Gegen diese „Kolonialschuldlüge“ richtete sich der Mythos, der sich um Paul von Lettow-Vorbeck rankte und bis weit in die Bundesrepublik reichte.
Dieser Mythos besagt, Lettow-Vorbeck hätte als genialer Feldherr mit seinen vermeintlich „treuen Askari“, den „loyalen Eingeborenen“, die Kolonie Deutsch-Ostafrika gegen die alliierte Übermacht verteidigt. Angeblich unbesiegt kehrte er nach Deutschland zurück. Der Historiker Uwe Schulte-Varendorff stellt klar, dass Lettow-Vorbeck keineswegs „ritterlich“ gekämpft habe, sondern eine „brutale, rücksichtslose und menschenverachtende Kriegsführung praktizierte“ und die angeblich treuen Askari ihn „der Herr, der unser Leichentuch schneidert“ nannten.
Im Nationalsozialismus wurde ab 1934 in Hamburg-Jenfeld die „Lettow-Vorbeck-Kaserne“ errichtet und zu Ehren des Generals benannt. An ihrem Eingangstor prangte das „Deutsch-Ostafrika-Kriegerdenkmal“, später „Askari-Reliefs“ genannt, das den Mythos der loyalen Eingeborenen aufgriff und visuell repräsentierte.
Die Kaserne wurde 1999 geschlossen, aber Büsten Lothar von Trothas und Paul von Lettow-Vorbecks prangen bis jetzt unkommentiert an den Gebäuden der ehemaligen Kaserne, die derzeit als Studentenwohnheim der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr dient.
Dieser Beitrag wurde im Digitalen Hamburger Geschichtsbuch erstveröffentlicht.
[6] Zitiert nach Horst Drechsler: Südwestafrika unter deutscher Kolonialherrschaft. Der Kampf der Herero und Nama gegen den deutschen Imperialismus (1884–1915), Berlin 19842, S. 156.
Während sich die G20 in den Hamburger Messehallen trafen, wurde ich u.a. zusammen mit Israel Kaunatjike für das Live-Fernsehprojekt There Is No Time interviewt und habe dort über Hamburg und den Kolonialismus gesprochen.
Das Video ist jetzt auch auf YouTube zu sehen:
Vortrag von Kim Sebastian Todzi im Rahmen der Ringvorlesung „Hamburg: Deutschlands Tor zur kolonialen Welt. Über den Umgang mit einem schwierigen Erbe“ mit einer Einführung von Prof. Dr. Jürgen Zimmerer.

Der Vortrag von Kim Todzi „Hamburg und die Gründung des deutschen Kolonialreichs unter Bismarck“ ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung – Nicht-kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.

Würde sich das ZDF nicht damit rühmen einen „authentischen, ethnografischen Blick auf den afrikanischen Kontinent“ produziert zu haben, diese Film-Besprechung über die ZDF-Herzkino-Reihe wäre wohl kaum geschrieben worden. Denn zu offensichtlich sind die folkloristischen, rassistischen und exotisierenden Klischees der Reihe, als dass der Verfasser es als notwendig empfunden hätte, im einzelnen darauf einzugehen.
Aber laut ZDF möchte „Jana und der Buschpilot“ „[…] mehr bieten als gutgemachte Unterhaltung, in der gar die überlegenen Weißen die Eingeborenen Schwarzafrikas mit den Errungenschaften westlicher Lebensart und Medizin beglücken. Vielmehr stellt Jana in der für sie fremden Welt ständig ihre Werte, Vorstellungen und Maßstäbe in Frage. […] Wir wollten keine afrikanische TV-Folklore präsentieren, sondern einen möglichst authentischen ethnografischen Blick auf den afrikanischen Kontinent, der es uns auch ermöglicht, aktuelle, relevante Probleme Afrikas zu erzählen. Denn der respektvolle Umgang mit anderen Kulturen und Lebensarten ist gerade in der heutigen Zeit wichtiger denn je.“ [1]
Und doch perpetuiert das ZDF erneut ein Afrika-Bild, das vor allem als Projektionsfläche Weißer Fantasien existiert. Ein Bild, in dem, trotz der angeblichen ethnografischen Authentizität, rückständiges Stammesrecht erst durch die Anwesenheit und die Initiative der Weißen Europäerin überwunden werden kann. Dieses Bild wird zudem noch verstärkt durch ein im besten Fall naiven, völlig unreflektierten Gebrauch von problematischen Begriffen (wie „Busch“ oder „Eingeborene“) selbst im redaktionellen Begleittext der Reihe.[2]
Im ersten Teil der Reihe „Krieg der Stämme“[3] verursacht ein Autounfall einen schweren Konflikt. Der Fahrer Obahir, vom (fiktiven?) „Stamm“ der „Fahskhars“, überfährt einen Hirten des verfeindeten „Stammes“ der „Jahkauv“. Bereits in dieser Szene sieht der deutsche Fernsehzuschauer eine sich bedrohlich formierende Gruppe Schwarzer, mit nackten Oberkörpern, bemalten Gesichtern und „traditionellen“ Beintüchern, mit Knüppeln und Stöcken bewaffnet auf die Kamera zuschreiten.
Die Gruppe verprügelt den Fahrer, die Stimmung ist aggressiv. Als das Flugzeug mit dem Buschpiloten Thomas Marrach und der herbeigerufenen Ärztin eintrifft, ruft die Ärztin Jana Vollendorf: „Oh Gott, der wird gelyncht.“
Bald wird klar, es gibt ein Abkommen zwischen den „Stämmen“: „Auge um Auge. Zahn um Zahn. Nicht originell, aber für solche Stämme wahrscheinlich das Beste“, wie der als skrupelloser Kapitalist dargestellte Investor Seth Millen bemerkt.
Dieser „Stammespakt“ (Vollendorf) sichere seit 30 Jahren den Frieden zwischen den „Stämmen“ und als der Hirte stirbt, fordern die „Jahkauv“ das Leben des Fahrers Obahirs.
Der Plot, angereichert um die Dimension der Kritik an der kapitalistischen Ausbeutung der Bodenschätze, wird angetrieben durch die Konfrontation von „Tradition“ und „Moderne“, europäischer Vernunft und afrikanischer Irrationalität. Dabei stehen die meisten afrikanischen Figuren für die „Tradition“ (oder ergeben sich in diese), Jana Vollendorf dagegen für die westliche „Moderne“. Die Irrationalität der „Tradition“ fasst Vollendorf zusammen: „Logik. Hier, wo Menschen sich gegenseitig umbringen, damit sie sich nicht gegenseitig umbringen.“
Damit reproduziert der Film das klassische kolonial geformte Bild des „Wilden“ und stellt ihm die Konstruktion einer identifikationsstiftenden Weißen, deutschen Frau entgegen, deren Anwesenheit im „Busch“ nicht nur durch ihre medizinischen Kenntnisse, sondern auch durch ihr zivilisatorisches Eingreifen legitimiert wird.
Die zusätzliche Dimension der Kritik an der kapitalistischen Inhumanität findet ebenfalls nur als Folie für die handelnden Weißen statt. Die Afrikaner werden auf ihren Status als Opfer reduziert, sind so kaum mehr als Requisiten in der Geschichte des Kampfes zwischen humanitärer Gesinnung Vollendorfs und der kapitalistischen Ausbeutung, vertreten durch den Minenbesitzer Michael Shorn und den Investor Seth Millen.
Im zweiten Teil der Reihe „Einsame Entscheidung“[4] retten der Buschpilot und die Ärztin den Ethnologen Philip Lavar, der am Marburg-Virus erkrankt ist. Bald stellt sich heraus, dass auch ein Kind des entlegenen Jhaskais-„Stammes“ infiziert ist.
Der „Stamm“ der Jhaskais „schottet sich seit jeher ab“ sagt die Krankenschwester Rosi zu Vollendorf. Als Vollendorf darauf erwidert, dass sie das Kind aber nicht einfach sterben lassen könne, betont Rosi: „Afrika ist nicht Deutschland. Hier gelten andere Regeln. Für uns gehört der Tod zum Leben dazu.“
Als die Ärztin die Jhaskais schließlich dennoch aufsucht, wird ein Ritual gezeigt, das Vollendorf an „die letzte Ölung“ erinnert: „Die kümmern sich gar nicht um die Genesung des Mädchens; die kümmern sich um ihren Tod.“ Auch in dieser Szene bezieht der Film seine Bildsprache aus dem Fundus des bestehenden kulturellen Archivs der etablierten Afrika-Bilder: bemalte Schwarze tanzen, mit Kalaschnikows bewaffnet, zum Sound von Buschtrommeln im Kreis um das Mädchen auf ihren Tod vorzubereiten.
Die Ärztin rettet das Kind durch eine Entführung und erzürnt dadurch den „Stamm“, der „Fremde“ hasst, das Krankenhaus mit Kalaschnikows angreift und nur durch das beherzte Eingreifen der männlichen Figuren in die Flucht geschlagen wird.
Wie im ersten Teil der Reihe wird der Plot durch die Konfrontation zwischen Tradition und Moderne angetrieben. Und wie im ersten Teil dient eine Weiße Figur, hier die hinterhältige und skrupellose Figur des Ethnologen Lavar, zur Abgrenzung und Einführung einer zusätzlichen Dimension der Legitimation: Die Afrikaner müssen vor den Umtrieben der egoistischen, unmenschlichen und skrupellosen Europäer geschützt werden.
Nur durch Vollendorfs Anwesenheit überlebt der „Stamm“, nur durch ihre Intervention wird der „stammes“-interne Streit gelöst.
Dabei zeigt sich die Konfrontation von afrikanischer „Tradition“ und europäischer „Moderne“ auch in der Bildsprache: hier die westlich gekleideten Weißen, die in repräsentativen kolonial-nostalgischen Steinbauten (erbaut: 1936) wohnen und arbeiten – dort die nackten, bemalten „Wilden“, die in primitiven Zelten und Hütten hausen.
Dabei versuchen die Filme durchaus teilweise zu differenzieren. Die Figuren Obahir (der Fahrer im ersten Teil) und Rosi (die Krankenschwester) zeigen Schwarze Menschen in moderner westlicher Kleidung. Rosi reflektiert sogar über den Widerspruch von afrikanischer Tradition und europäischer Zivilisation. Bemerkenswert bleibt aber, dass im Gegensatz zu den Weißen Figuren die Schwarzen Figuren keine Nachnamen tragen und dass offensichtlich die Nähe zu den Weißen Hauptfiguren ein entscheidendes Kriterium für diese positive Zuordnung ist.
Die Reduktion und Homogenisierung Afrikas zu einem unbestimmten „Schwarzafrika“, in welchem „Stämme“ sich aufgrund von archaischen Traditionen gegenseitig umbringen oder aufgrund von Xenophobie die Weißen, die „nur helfen wollen“, mit Kalaschnikows angreifen, dient so auch zur Selbstaffirmation des friedvollen, aufgeklärten und modernen „Eigenen“, das dem so inszenierten „Anderen“ diametral gegenübersteht.[5] Die meisten dargestellten „Eingeborenen“ befinden sich auf einer niedrigeren Entwicklungsstufe, die das eigene, unmarkierte Weißsein zur zu erreichenden Norm erhebt. Diese Denk- und Sprachmuster weisen eine deutliche Kontinuität in den (deutschen) Kolonialismus auf, in dem ebenfalls das zivilisatorische Sendungsbewusstsein die Kolonialherrschaft als Zivilisierungsmission rechtfertigen sollte. Dass dieser Export von Normen und Werten durch die Protagonisten in den Filmen durchaus in Frage gestellt wird, dient letztlich auch nur zur postmodernen Legitimation des eigenen Handelns. Denn die moralische Richtigkeit, z.B. das Leben des unschuldigen Kindes zu retten, kann durch die Konstruktion des Plots kaum ernsthaft in Zweifel gezogen werden.
Es mag kaum verwundern, dass in der Reihe „Herzkino“ zudem die Konstruktion von weiblicher und männlicher Weißheit klassischen Rollenklischees entspricht: dort der männliche Abenteurer (Buschpilot) und hier die weibliche Ärztin. Auch wenn diese Anknüpfung sicher nicht bewusst geschehen ist: Krankenpflege war tatsächlich neben der christlichen Mission die klassische Rolle für Frauen in den deutschen Kolonien.[6]
Mit dieser Mischung aus trivialer Liebesgeschichte, Abenteuer, Exotik und zivilisatorischer Überlegenheit fügt sich die Reihe nahtlos in einen Afrika-Diskurs ein, der tief in kolonial-nostalgischen Narrativen wurzelt. Dass das ZDF „keine afrikanische TV-Folklore“ produzieren wollte, mag man angesichts dessen kaum glauben.
[1] https://presseportal.zdf.de/pm/jana-und-der-buschpilot/, zuletzt eingesehen am 20.9.2015.
[2] Für eine Einführung in diese problematischen Begrifflichkeiten vgl.: Arndt, Susan; Hornscheid, Antje (Hrsg.):
Afrika und die deutsche Sprache. Ein kritisches Nachschlagewerk, 2. Aufl., Münster 2009.
[3] http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2462052/Jana-und-der-Buschpilot-%2528Teil-2%2529#/beitrag/video/2462040/Jana-und-der-Buschpilot-%28Teil-1%29, zuletzt eingesehen am 20.9.2015.
[4] http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2462052/Jana-und-der-Buschpilot-%2528Teil-2%2529#/beitrag/video/2462052/Jana-und-der-Buschpilot-%28Teil-2%29, zuletzt eingesehen am 20.9.2015.
[5] Siehe dazu v.a. die Werke Saids, der die kulturelle Konstruktion des „orientalen Anderen“ als kulturelles Gegenbild des „okzidentalen Eigenen“ in seiner bahnbrechenden Studie „Orientalism“ analysierte und später diese Analyse der Betrachtung kultureller Praxen auf weitere „Kulturräume“ ausweitete: Said, Edward: Orientalismus, Frankfurt am Main 2009; ders.: Kultur und Imperialismus. Einbildungskraft und Politik im Zeitalter der Macht, Frankfurt am Main 1993. Zur Kritik an Saids teilweise essenzialistischen Ideen aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive siehe: MacKenzie, John M.: Orientalism. History, theory and the arts, Manchester 1995.
[6] Vgl. Dietrich, Anette: Weiße Weiblichkeiten. Konstruktion von „Rasse“ und Geschlecht im deutschen Kolonialismus, Bielefeld 2007, S. 254-258.

Dieser Text von Kim Sebastian Todzi ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.
—
Bildquelle:
All rights reserved: obs/ZDF/ZDF/Ilze Kitshoff URL: http://www.presseportal.de/pm/7840/3117845
Die Forschungsstelle „Hamburgs (post-)koloniales Erbe/Hamburg und die frühe Globalisierung“ der Universität Hamburg hat jetzt neben einer Facebook-Seite auch einen eigenen Blog, in dem in loser Folge zentrale Entwicklungen auf dem Gebiet der kolonialen Erinnerung, der historischen Erforschung des deutschen Kolonialismus und der Arbeit der Forschungsstelle in Hamburg als Essays und Podcasts veröffentlicht werden: Zum Blog.
Christa Goetsch sprach am 22.01.2015 in der Hamburgischen Bürgerschaft über die Aufarbeitung des (post-)kolonialen Erbes, welche einen „langen Atem“ und „Durchhaltevermögen“ benötige.