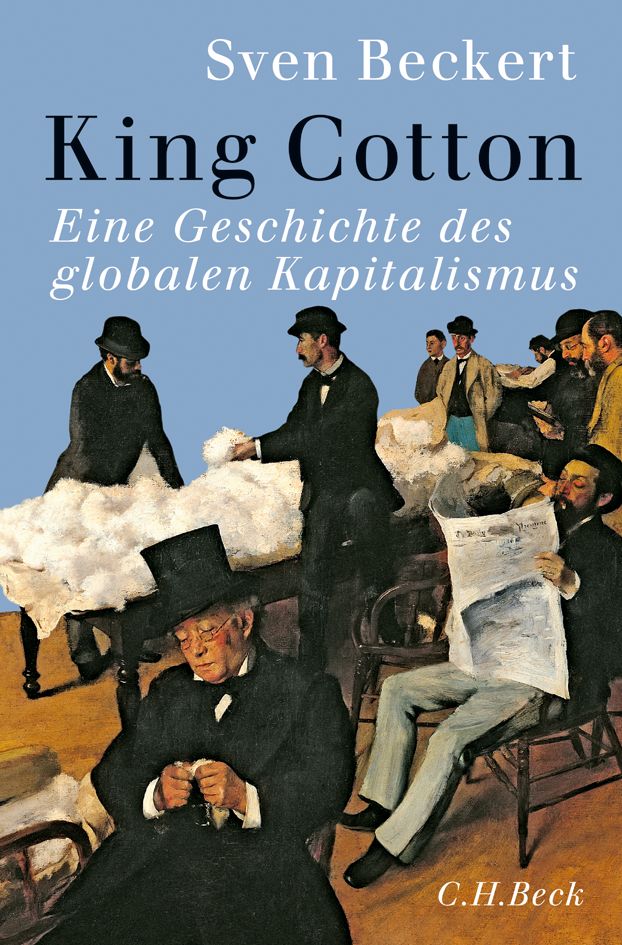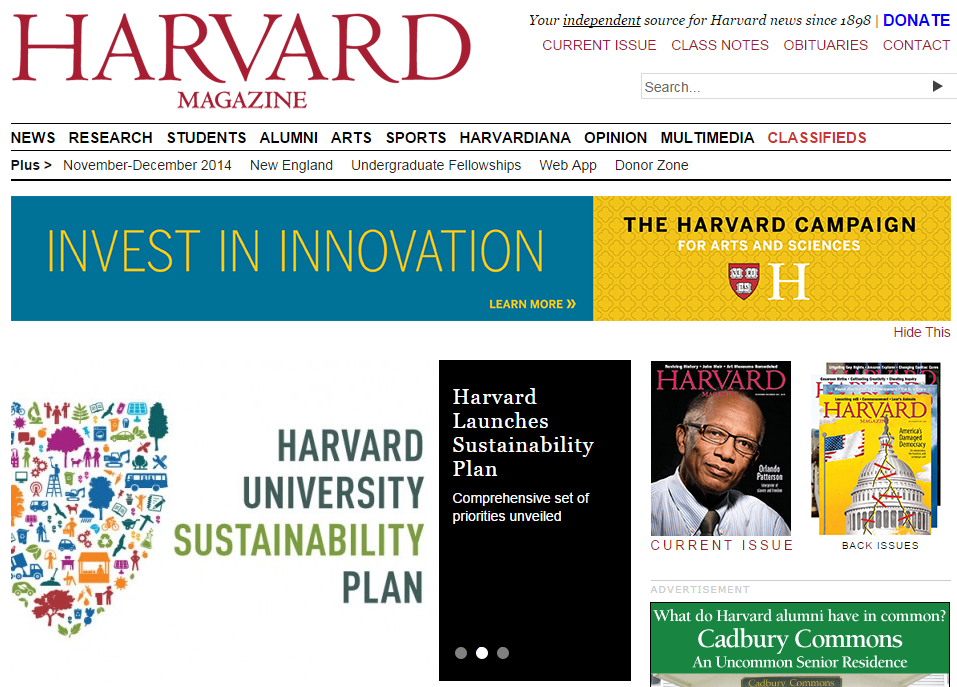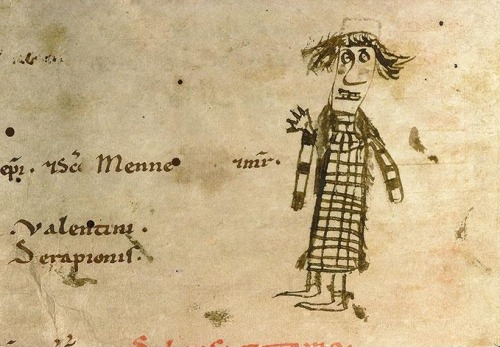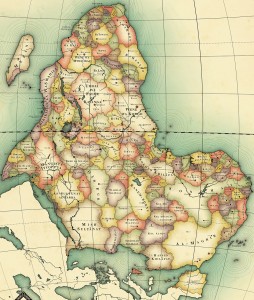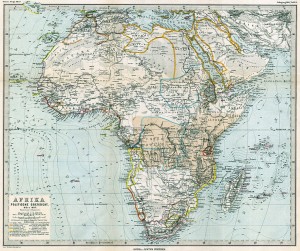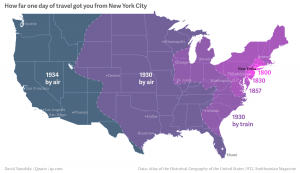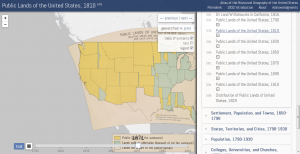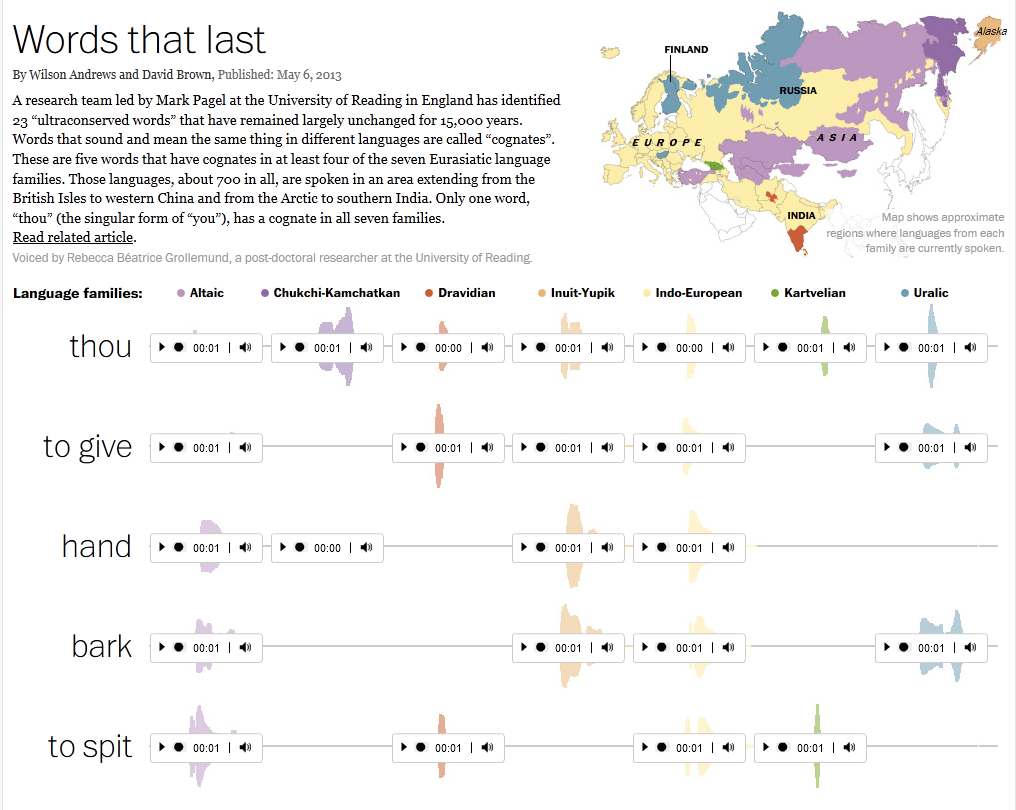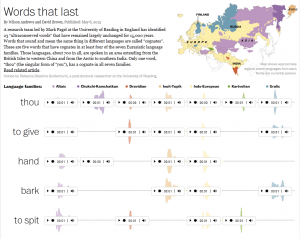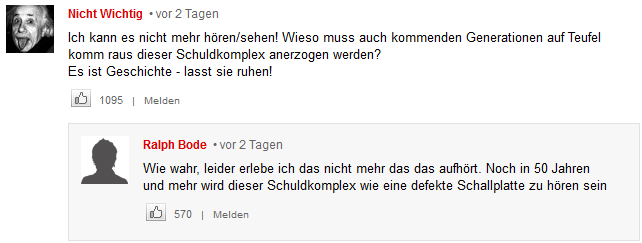![9783406659218_cover[1]](http://www.kim-todzi.de/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/9783406659218_cover1-197x300.jpg) In der Geschichtswissenschaft hat sich in den letzten Jahren ein Paradigmenwechsel vollzogen: unter dem Etikett der „transnationalen“ bzw. „Globalgeschichte“ werden in einem stark wachsenden Feld der Geschichtswissenschaft Wechselwirkungen und Verflechtungen der globalisierten Welt untersucht und dabei der Versuch unternommen, die eurozentrische und nationalgeschichtliche Perspektive älterer Historiografie zu überwinden.[1]
In der Geschichtswissenschaft hat sich in den letzten Jahren ein Paradigmenwechsel vollzogen: unter dem Etikett der „transnationalen“ bzw. „Globalgeschichte“ werden in einem stark wachsenden Feld der Geschichtswissenschaft Wechselwirkungen und Verflechtungen der globalisierten Welt untersucht und dabei der Versuch unternommen, die eurozentrische und nationalgeschichtliche Perspektive älterer Historiografie zu überwinden.[1]
Insbesondere global gehandelte Güter wie Kaffee, Zucker, Tee oder Baumwolle bieten sich an, transnationale Verflechtungen kenntlich zu machen und ermöglichen eine Verbindung von regionaler Mikro- mit globaler Makrogeschichte.[2]
Der Harvard-Professor Sven Beckert hat nun mit „King Cotton. Eine Geschichte des globalen Kaptialismus“ eine beeindruckende Studie vorgelegt, die anhand Baumwollproduktion und –industrie Antworten auf die Frage sucht, warum und wie es zu den bis heute wirkmächtigen Unterschieden zwischen dem globalen Norden und Süden – der „Great Divirgence“ gekommen ist.[3]
Dass Beckert Baumwolle in den Fokus seiner Forschung stellt, ist einleuchtend: Wie kaum ein anderer Rohstoff steht die Veränderung der Baumwollproduktion am Anfang der globalen Ausbreitung des Kapitalismus – von intensiver Arbeitsteilung, Produktionssteigerung und expandierender sozialer Ungleichheit.
Dabei begnügt sich Beckert nicht mit konventionellen Antworten im Rahmen des Modernisierungsnarrativs – nach dem Demokratisierung, Rechtsstaatlichkeit und Kapitalismus zusammengedacht werden, sondern stellt Zusammenhänge zwischen der Transformation des Wirtschaftssystems und der imperialen Expansion her. Denn, so Beckert, Sklaverei, kolonialer Landraub und der Einsatz von Zwang und Gewalt zur Gewinnmaximierung seien nicht nur Ausrutscher des kapitalistischen Systems. Vielmehr stünde die von ihm als „Kriegskapitalismus“ bezeichnete Phase der „Enteignung von Land und Arbeitern in Afrika, Asien und den Amerikas“ am Anfang eines sich global ausbreitenden Kapitalismus und brachte den Industriekapitalismus erst hervor.
Damit widerspricht Beckert auch einem Trugschluss wirtschaftsliberaler Theoretiker, dass sich der Markt optimaler Weise ohne die Einmischung des Staates entwickeln würde. Der Staat habe im Gegenteil erst die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass es einen Markt gibt. Die Genese und Entwicklung moderner Nationalstaaten und die Globalisierung schlössen demzufolge auch nicht aus sondern bedingen und verstärkten sich wechselseitig: „Wenn unser angeblich neues globales Zeitalter sich auf revolutionäre Weise von der Vergangenheit unterscheidet, […] dann dadurch, dass Kapitalbesitzer erstmals in der Lage sind sich von genau jenen Nationalstaaten zu emanzipieren, die in der Vergangenheit ihren Aufstieg ermöglicht haben.“[4]
Beckerts Verdienst ist, dass er diese Zusammenhänge nicht nur als große These verfolgt, sondern sie auf einer breiten empirischen Basis belegt. Herausgekommen ist keine theoretische Analyse des globalen Kapitalismus sondern ein Breites Panorama des „Kapitalismus in Aktion“.
—
[1] In den letzten Jahren erschien eine Reihe globalgeschichtlicher Studien, von denen drei herausragende Arbeiten genannt werden sollen: Bayly, Christopher Alan: Die Geburt der modernen Welt. Eine Globalgeschichte 1780 – 1914, Frankfurt 2006; Wendt, Reinhard: Vom Kolonialismus zur Globalisierung. Europa und die Welt seit 1500, Paderborn [u.a.] 2007; Osterhammel, Jürgen: Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts, München 2009. Viele Studien, denen das Etikett „transnationale“ bzw. „Globalgeschichte“ anhaftet, sind freilich Studien globaler Phänomene im nationalen Kontext. Oft ist der Unterschied zur historischen Komparatistik zudem unklar. Der schwierigen Etikettierung zum Trotz, erweitern diese Arbeiten die Perspektive der nationalen Geschichtsschreibung und ermöglichen dadurch einen fruchtbaren Zugriff auf historische Gemengelagen, so u.a. Conrad, Sebastian: Globalisierung und Nation im deutschen Kaiserreich, München 2006.
[2] Vgl. u.a.: Clarence-Smith, W. G.; Topik, Steven: The global coffee economy in Africa, Asia and Latin America, 1500-1989, Cambridge, UK, New York 2003; Mintz, Sidney W.: Sweetness and power. The place of sugar in modern history, New York 1985; Mair, Victor H.; Hoh, Erling: The true history of tea, New York, London 2009; Riello, Giorgio: Cotton. The fabric that made the modern world, Cambridge 2013.
[3] Pomeranz, Kenneth: The great divergence. China, Europe, and the making of the modern world economy, Princeton, N.J. 2000.
[4] Beckert, Sven: King Cotton: Eine Globalgeschichte des Kapitalismus, München 2014, S. 17.