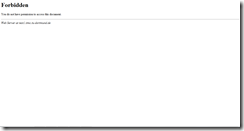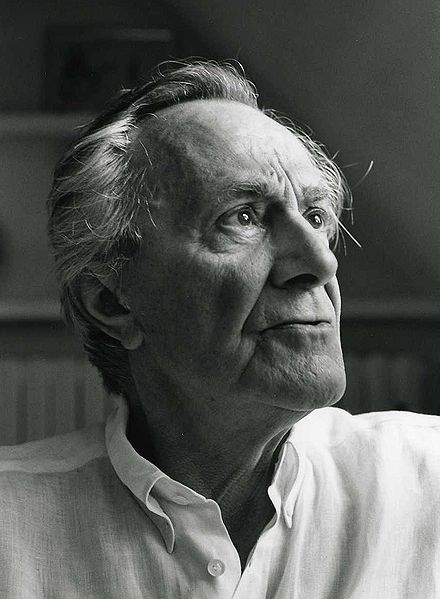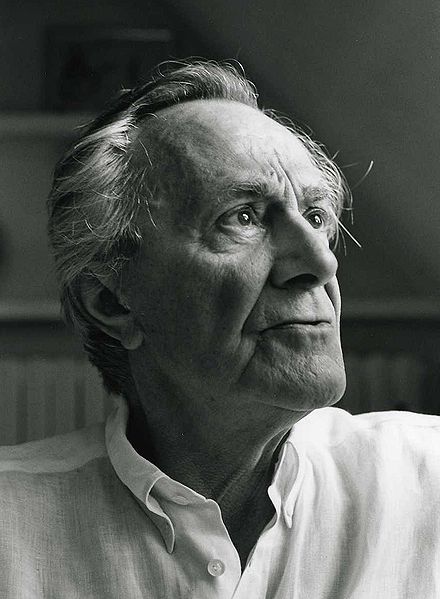Die Sehepunkte sind ein monatlich online erscheinendes Rezensionsjournal für geschichtswissenschaftliche Veröffentlichungen. Seit 2001 erscheint das Journal und ich – wie viele Kollegen – habe den Newsletter abonniert und freue mich jeden Monat wieder über das Erscheinen.
Im letzten Newsletter bat das Redaktionsteam nun um Feedback:
In diesem Monat möchten wir Sie alle darüber hinaus aber noch zu einer Stellungnahme einladen: Die sehepunkte erscheinen nun seit über 11 Jahren zwar ausschließlich online, aber im vergleichsweise traditionellen Gewand einer monatlichen Zeitschrift. Angesichts von RSS-Feeds, Blogs und zahlreichen sozialen Netzwerken bzw. Kommunikationskanälen wird diese Publikationsform inzwischen gelegentlich als „überholt“ oder „die Möglichkeiten des Netzes nicht ausreichend nutzend“ klassifiziert. Was halten Sie davon? Sollten die sehepunkte ihre Erscheinungsform beibehalten oder den Journalcharakter tendenziell auflösen? Wir freuen uns über möglichst zahlreiche Wortmeldungen unter: redaktion@sehepunkte.de !
Und da ich meine Gedanken nicht nur mit der Redaktion teilen will, folgen an dieser Stelle einige kurz angerissene Ideen.
Zunächst einmal: Endlich! Endlich fragt man die Nutzer des Angebots, wie sie es nutzen und was sie sich in Zukunft wünschen würden. Das ist bereits ein entscheidender Schritt in der Verbesserung des Onlineauftritts. Das ist tatsächlich „die Möglichkeiten des Netzes […] ausnutzen“. Die direkte Kommunikation mit den Nutzern ist ein entscheidender aber viel zu oft unterschätzter Vorteil von Online-Angeboten.
Zur Frage: Ja. Diese Publikationsform als einzige Form zu nutzen, ist absolut und ohne Frage überholt. Es spricht überhaupt nichts dagegen (von internen Prozessen möglicherweise abgesehen) Rezensionen sofort nach ihrer redaktionellen Prüfung online zu stellen. Denn das Eine (ein monatlich erscheinendes Online-Journal und Newsletter) schließt das andere (die sofortige Veröffentlichung) nicht gegenseitig aus. Das ist doch das tolle: Jedem Nutzer seine Nutzungsgewohnheit!
Toll ist aber auch, dass es bereits einen Facebook-Fanpage und einen Twitter-Account der sehepunkte gibt. Unklar bleibt, warum von der Homepage keine Links zu diesen Auftritten gesetzt sind (oder diese so versteckt sind, dass ich sie einfach nicht finden konnte).
Sicher, die Seite könnte durchaus mal wieder überarbeitet werden und das angestaubte Design loswerden, aber sie bleibt inhaltlich eine der besten Seiten für deutschsprachige Historiker im Netz. Die langsame Anpassung an Online-Modi ist absolut wünschenswert und lässt auf die weitere Entwicklung gespannt warten.