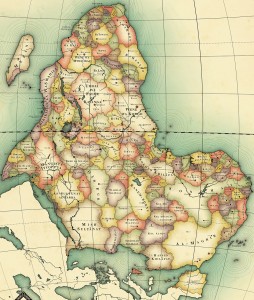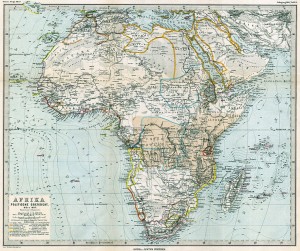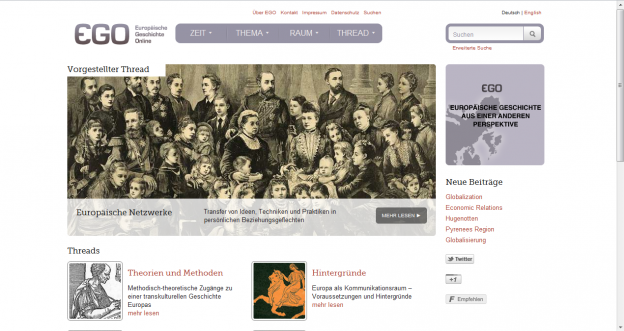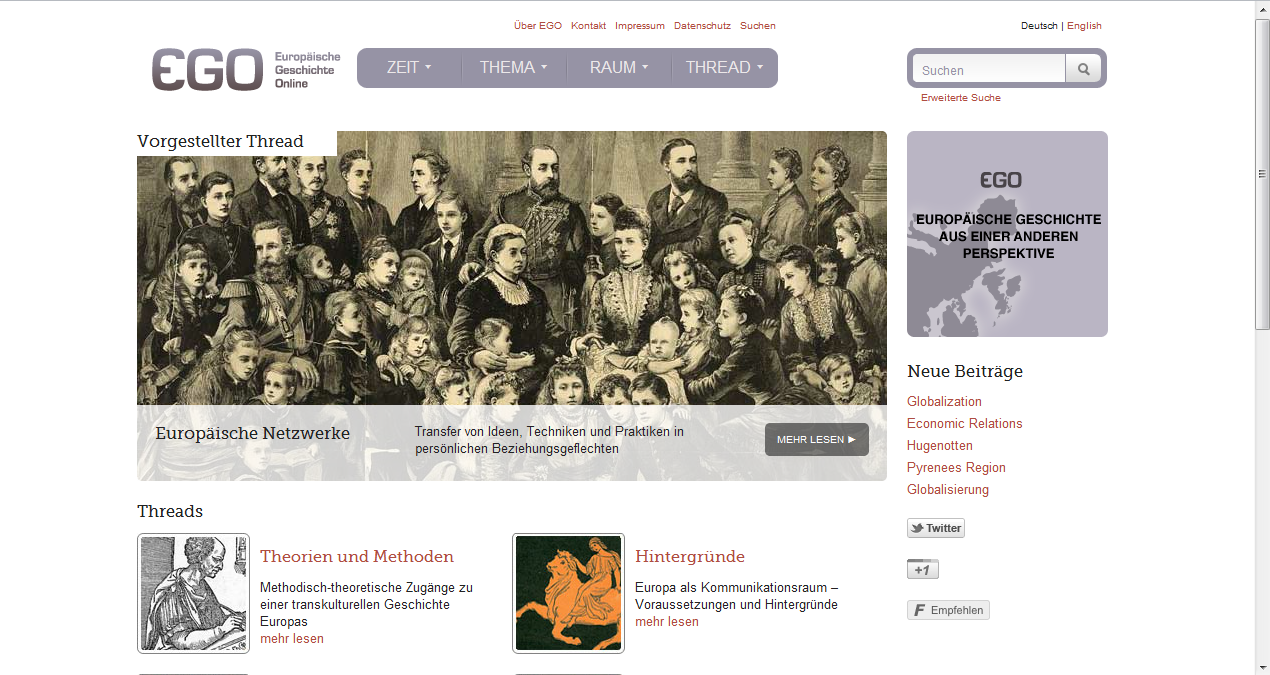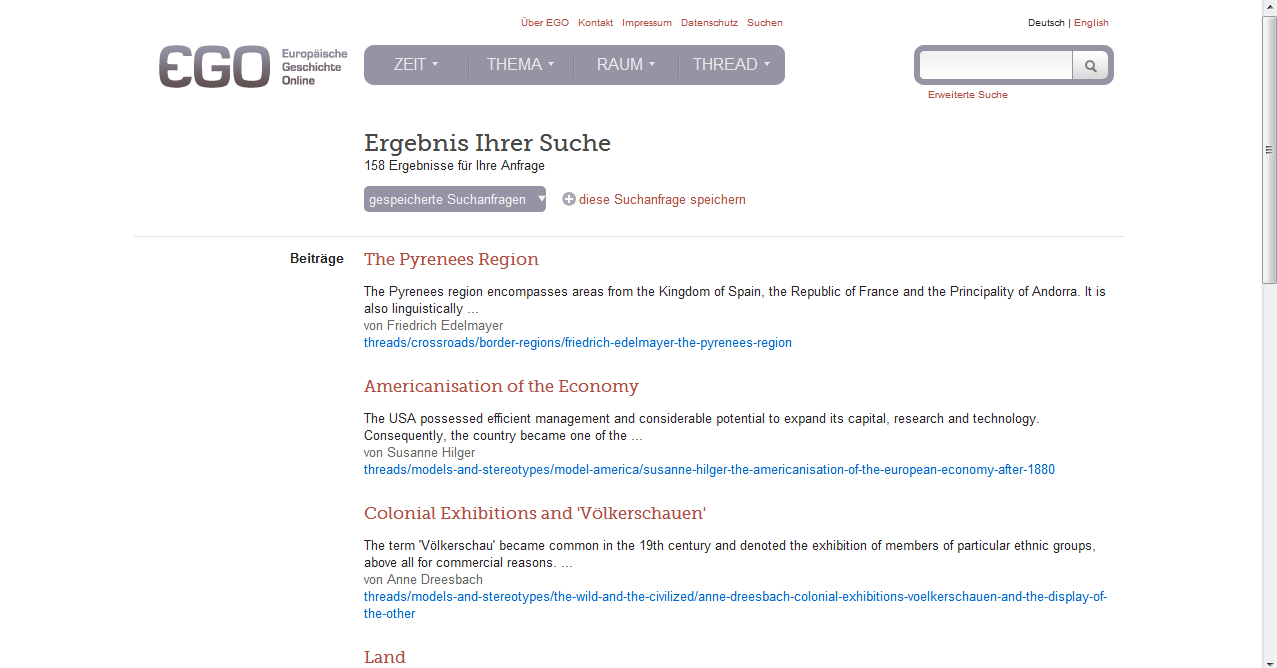Würde sich das ZDF nicht damit rühmen einen „authentischen, ethnografischen Blick auf den afrikanischen Kontinent“ produziert zu haben, diese Film-Besprechung über die ZDF-Herzkino-Reihe wäre wohl kaum geschrieben worden. Denn zu offensichtlich sind die folkloristischen, rassistischen und exotisierenden Klischees der Reihe, als dass der Verfasser es als notwendig empfunden hätte, im einzelnen darauf einzugehen.
Aber laut ZDF möchte „Jana und der Buschpilot“ „[…] mehr bieten als gutgemachte Unterhaltung, in der gar die überlegenen Weißen die Eingeborenen Schwarzafrikas mit den Errungenschaften westlicher Lebensart und Medizin beglücken. Vielmehr stellt Jana in der für sie fremden Welt ständig ihre Werte, Vorstellungen und Maßstäbe in Frage. […] Wir wollten keine afrikanische TV-Folklore präsentieren, sondern einen möglichst authentischen ethnografischen Blick auf den afrikanischen Kontinent, der es uns auch ermöglicht, aktuelle, relevante Probleme Afrikas zu erzählen. Denn der respektvolle Umgang mit anderen Kulturen und Lebensarten ist gerade in der heutigen Zeit wichtiger denn je.“ [1]
Und doch perpetuiert das ZDF erneut ein Afrika-Bild, das vor allem als Projektionsfläche Weißer Fantasien existiert. Ein Bild, in dem, trotz der angeblichen ethnografischen Authentizität, rückständiges Stammesrecht erst durch die Anwesenheit und die Initiative der Weißen Europäerin überwunden werden kann. Dieses Bild wird zudem noch verstärkt durch ein im besten Fall naiven, völlig unreflektierten Gebrauch von problematischen Begriffen (wie „Busch“ oder „Eingeborene“) selbst im redaktionellen Begleittext der Reihe.[2]
„Krieg der Stämme“
Im ersten Teil der Reihe „Krieg der Stämme“[3] verursacht ein Autounfall einen schweren Konflikt. Der Fahrer Obahir, vom (fiktiven?) „Stamm“ der „Fahskhars“, überfährt einen Hirten des verfeindeten „Stammes“ der „Jahkauv“. Bereits in dieser Szene sieht der deutsche Fernsehzuschauer eine sich bedrohlich formierende Gruppe Schwarzer, mit nackten Oberkörpern, bemalten Gesichtern und „traditionellen“ Beintüchern, mit Knüppeln und Stöcken bewaffnet auf die Kamera zuschreiten.
Die Gruppe verprügelt den Fahrer, die Stimmung ist aggressiv. Als das Flugzeug mit dem Buschpiloten Thomas Marrach und der herbeigerufenen Ärztin eintrifft, ruft die Ärztin Jana Vollendorf: „Oh Gott, der wird gelyncht.“
Bald wird klar, es gibt ein Abkommen zwischen den „Stämmen“: „Auge um Auge. Zahn um Zahn. Nicht originell, aber für solche Stämme wahrscheinlich das Beste“, wie der als skrupelloser Kapitalist dargestellte Investor Seth Millen bemerkt.
Dieser „Stammespakt“ (Vollendorf) sichere seit 30 Jahren den Frieden zwischen den „Stämmen“ und als der Hirte stirbt, fordern die „Jahkauv“ das Leben des Fahrers Obahirs.
Der Plot, angereichert um die Dimension der Kritik an der kapitalistischen Ausbeutung der Bodenschätze, wird angetrieben durch die Konfrontation von „Tradition“ und „Moderne“, europäischer Vernunft und afrikanischer Irrationalität. Dabei stehen die meisten afrikanischen Figuren für die „Tradition“ (oder ergeben sich in diese), Jana Vollendorf dagegen für die westliche „Moderne“. Die Irrationalität der „Tradition“ fasst Vollendorf zusammen: „Logik. Hier, wo Menschen sich gegenseitig umbringen, damit sie sich nicht gegenseitig umbringen.“
Damit reproduziert der Film das klassische kolonial geformte Bild des „Wilden“ und stellt ihm die Konstruktion einer identifikationsstiftenden Weißen, deutschen Frau entgegen, deren Anwesenheit im „Busch“ nicht nur durch ihre medizinischen Kenntnisse, sondern auch durch ihr zivilisatorisches Eingreifen legitimiert wird.
Die zusätzliche Dimension der Kritik an der kapitalistischen Inhumanität findet ebenfalls nur als Folie für die handelnden Weißen statt. Die Afrikaner werden auf ihren Status als Opfer reduziert, sind so kaum mehr als Requisiten in der Geschichte des Kampfes zwischen humanitärer Gesinnung Vollendorfs und der kapitalistischen Ausbeutung, vertreten durch den Minenbesitzer Michael Shorn und den Investor Seth Millen.
„Einsame Entscheidung“
Im zweiten Teil der Reihe „Einsame Entscheidung“[4] retten der Buschpilot und die Ärztin den Ethnologen Philip Lavar, der am Marburg-Virus erkrankt ist. Bald stellt sich heraus, dass auch ein Kind des entlegenen Jhaskais-„Stammes“ infiziert ist.
Der „Stamm“ der Jhaskais „schottet sich seit jeher ab“ sagt die Krankenschwester Rosi zu Vollendorf. Als Vollendorf darauf erwidert, dass sie das Kind aber nicht einfach sterben lassen könne, betont Rosi: „Afrika ist nicht Deutschland. Hier gelten andere Regeln. Für uns gehört der Tod zum Leben dazu.“
Als die Ärztin die Jhaskais schließlich dennoch aufsucht, wird ein Ritual gezeigt, das Vollendorf an „die letzte Ölung“ erinnert: „Die kümmern sich gar nicht um die Genesung des Mädchens; die kümmern sich um ihren Tod.“ Auch in dieser Szene bezieht der Film seine Bildsprache aus dem Fundus des bestehenden kulturellen Archivs der etablierten Afrika-Bilder: bemalte Schwarze tanzen, mit Kalaschnikows bewaffnet, zum Sound von Buschtrommeln im Kreis um das Mädchen auf ihren Tod vorzubereiten.
Die Ärztin rettet das Kind durch eine Entführung und erzürnt dadurch den „Stamm“, der „Fremde“ hasst, das Krankenhaus mit Kalaschnikows angreift und nur durch das beherzte Eingreifen der männlichen Figuren in die Flucht geschlagen wird.
Wie im ersten Teil der Reihe wird der Plot durch die Konfrontation zwischen Tradition und Moderne angetrieben. Und wie im ersten Teil dient eine Weiße Figur, hier die hinterhältige und skrupellose Figur des Ethnologen Lavar, zur Abgrenzung und Einführung einer zusätzlichen Dimension der Legitimation: Die Afrikaner müssen vor den Umtrieben der egoistischen, unmenschlichen und skrupellosen Europäer geschützt werden.
Nur durch Vollendorfs Anwesenheit überlebt der „Stamm“, nur durch ihre Intervention wird der „stammes“-interne Streit gelöst.
Dabei zeigt sich die Konfrontation von afrikanischer „Tradition“ und europäischer „Moderne“ auch in der Bildsprache: hier die westlich gekleideten Weißen, die in repräsentativen kolonial-nostalgischen Steinbauten (erbaut: 1936) wohnen und arbeiten – dort die nackten, bemalten „Wilden“, die in primitiven Zelten und Hütten hausen.
Dabei versuchen die Filme durchaus teilweise zu differenzieren. Die Figuren Obahir (der Fahrer im ersten Teil) und Rosi (die Krankenschwester) zeigen Schwarze Menschen in moderner westlicher Kleidung. Rosi reflektiert sogar über den Widerspruch von afrikanischer Tradition und europäischer Zivilisation. Bemerkenswert bleibt aber, dass im Gegensatz zu den Weißen Figuren die Schwarzen Figuren keine Nachnamen tragen und dass offensichtlich die Nähe zu den Weißen Hauptfiguren ein entscheidendes Kriterium für diese positive Zuordnung ist.
Die Reduktion und Homogenisierung Afrikas zu einem unbestimmten „Schwarzafrika“, in welchem „Stämme“ sich aufgrund von archaischen Traditionen gegenseitig umbringen oder aufgrund von Xenophobie die Weißen, die „nur helfen wollen“, mit Kalaschnikows angreifen, dient so auch zur Selbstaffirmation des friedvollen, aufgeklärten und modernen „Eigenen“, das dem so inszenierten „Anderen“ diametral gegenübersteht.[5] Die meisten dargestellten „Eingeborenen“ befinden sich auf einer niedrigeren Entwicklungsstufe, die das eigene, unmarkierte Weißsein zur zu erreichenden Norm erhebt. Diese Denk- und Sprachmuster weisen eine deutliche Kontinuität in den (deutschen) Kolonialismus auf, in dem ebenfalls das zivilisatorische Sendungsbewusstsein die Kolonialherrschaft als Zivilisierungsmission rechtfertigen sollte. Dass dieser Export von Normen und Werten durch die Protagonisten in den Filmen durchaus in Frage gestellt wird, dient letztlich auch nur zur postmodernen Legitimation des eigenen Handelns. Denn die moralische Richtigkeit, z.B. das Leben des unschuldigen Kindes zu retten, kann durch die Konstruktion des Plots kaum ernsthaft in Zweifel gezogen werden.
Es mag kaum verwundern, dass in der Reihe „Herzkino“ zudem die Konstruktion von weiblicher und männlicher Weißheit klassischen Rollenklischees entspricht: dort der männliche Abenteurer (Buschpilot) und hier die weibliche Ärztin. Auch wenn diese Anknüpfung sicher nicht bewusst geschehen ist: Krankenpflege war tatsächlich neben der christlichen Mission die klassische Rolle für Frauen in den deutschen Kolonien.[6]
Mit dieser Mischung aus trivialer Liebesgeschichte, Abenteuer, Exotik und zivilisatorischer Überlegenheit fügt sich die Reihe nahtlos in einen Afrika-Diskurs ein, der tief in kolonial-nostalgischen Narrativen wurzelt. Dass das ZDF „keine afrikanische TV-Folklore“ produzieren wollte, mag man angesichts dessen kaum glauben.
[1] https://presseportal.zdf.de/pm/jana-und-der-buschpilot/, zuletzt eingesehen am 20.9.2015.
[2] Für eine Einführung in diese problematischen Begrifflichkeiten vgl.: Arndt, Susan; Hornscheid, Antje (Hrsg.):
Afrika und die deutsche Sprache. Ein kritisches Nachschlagewerk, 2. Aufl., Münster 2009.
[3] http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2462052/Jana-und-der-Buschpilot-%2528Teil-2%2529#/beitrag/video/2462040/Jana-und-der-Buschpilot-%28Teil-1%29, zuletzt eingesehen am 20.9.2015.
[4] http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2462052/Jana-und-der-Buschpilot-%2528Teil-2%2529#/beitrag/video/2462052/Jana-und-der-Buschpilot-%28Teil-2%29, zuletzt eingesehen am 20.9.2015.
[5] Siehe dazu v.a. die Werke Saids, der die kulturelle Konstruktion des „orientalen Anderen“ als kulturelles Gegenbild des „okzidentalen Eigenen“ in seiner bahnbrechenden Studie „Orientalism“ analysierte und später diese Analyse der Betrachtung kultureller Praxen auf weitere „Kulturräume“ ausweitete: Said, Edward: Orientalismus, Frankfurt am Main 2009; ders.: Kultur und Imperialismus. Einbildungskraft und Politik im Zeitalter der Macht, Frankfurt am Main 1993. Zur Kritik an Saids teilweise essenzialistischen Ideen aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive siehe: MacKenzie, John M.: Orientalism. History, theory and the arts, Manchester 1995.
[6] Vgl. Dietrich, Anette: Weiße Weiblichkeiten. Konstruktion von „Rasse“ und Geschlecht im deutschen Kolonialismus, Bielefeld 2007, S. 254-258.

Dieser Text von Kim Sebastian Todzi ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.
—
Bildquelle:
All rights reserved: obs/ZDF/ZDF/Ilze Kitshoff URL: http://www.presseportal.de/pm/7840/3117845